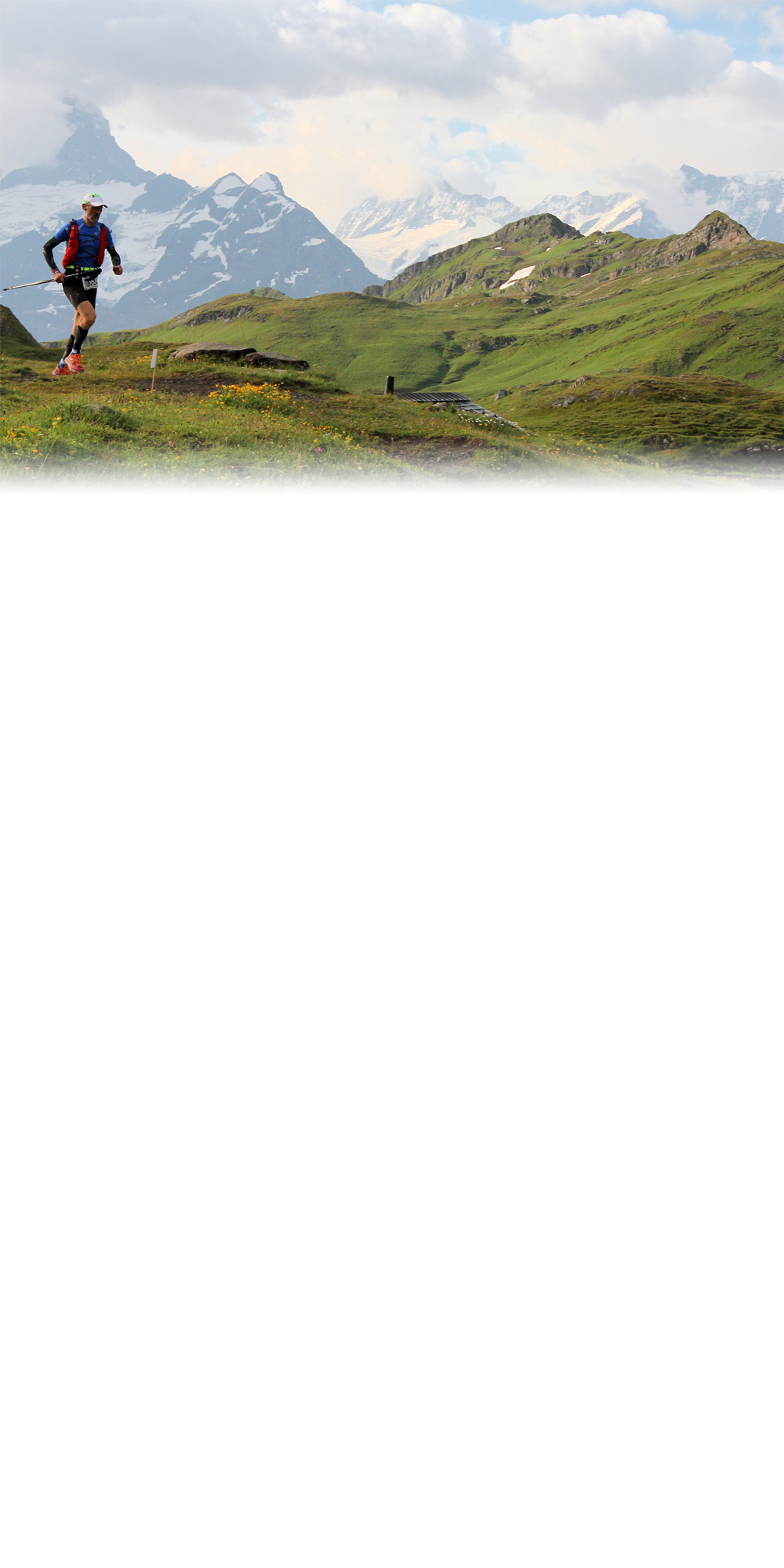10.08.14 - Monschau-Marathon
Mord(s) Eifel
„Balzplatz für Birkhähne
und Schauplatz für Morde“
Nur wenige Kilometer laufen wir entlang über naturnahe Wanderwege des über dreihundert Kilometer langen Premium-Wanderweg „Eifelsteig“ mit seinen 15 Etappen. Dabei führt der Steig vom Norden bei Aachen hier über das „Hohe Venn“, weiter durchs Rurtal, über die Kalk- und die Vulkaneifel bis hin zur Südeifel in Trier. Das „Hohe Venn“ erlebt man auf Etappe zwei. Licht und Schatten wechseln sich ab.
Ich würde zu gerne mal einen Blick hinter die Büsche wagen, dort wo ein schmaler Holzboden tief ins Moor bis in die Schutzzonen führt. Ein Wiederholungstäter, und damit meine ich einen mehrfachen Monschau Ultramarathonstarter, warnt mich, es zu probieren. Im Winter seien schon einige verunglückt oder erfroren.
Sofort geht meine Phantasie wieder mit mir durch. Pures Entsetzen scheint mir ins Gesicht geschrieben, als er von den grasbewachsenen und verklumpten Erdbüscheln, die von den Eifelanern als Totenköpfe bezeichnet werden, lebhaft berichtet. Es braucht nun nicht wirklich viel Vorstellungskraft, um sich diese Erdhügel als Schädeldecken vorzustellen, die einst im Sog des größten Hochmoors Europas untergegangen sein könnten, umgeben von den fleischfressenden Pflanzen mit scheinheiligen Namen wie Siebenstern oder Sonnentau.
Unlängst, erzählt er mir weiter, fand ein Schäfer die menschlichen Überreste eines Versunkenen in einem der unzähligen Wasserlöcher. Die wiederum kommen von den mehr als hundertvierzig Liter Regenwasser, die hier im Jahr auf einen Quadratmeter fallen sollen. Von 365 Tagen im Jahr ist das auf 690 Metern über N. N. gelegene Hohe Venn 175 Tage im milchigen Nebel, 172 Tage vom Regen begossen, der wiederum an 43 Tagen als Schneesturm über die Moorflächen bläst. Bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von bestenfalls sechs Grad bietet dies alles einen erstklassigen Nährboden für den Runzelbruder und die Zackenmütze, um nur zwei von jeweils 300 Flechten- oder Moosarten zu nennen.
Ja, ich sehe es endlich ein, ein Mord ist schnell geschehen und der Ort ideal zum Versenken der Leiche. Der Wiederholungstäter spielt aber nur auf die nassen Füße und Unterschenkel an, die man sich bei dieser Aktion holen könnte, denn tiefer sei das Moor nicht. Keine Fiktion dagegen ist das, was sich im letzten Weltkrieg am Himmel über dem Hohen Venn ereignete. Ein mächtiges Kreuz erinnert an die Soldaten, die mit ihren Maschinen abgeschossen oder in einer dichten Nebelbank zusammenstießen und in der morastigen Sumpflandschaft aufschlugen. Heute ist das Gebiet in ausgewiesenen Schutzzonen von A, B, C gegliedert. C ist die ökologisch empfindsamste der drei Zonen, in die auch die Ranger nicht mehr als zwei Mal im Monat gehen dürfen, denn in den sechziger Jahren gab es hier oben mehr Autos als Birkhühner. Ende der siebziger Jahre erkannte man dann endlich die Wichtigkeit dieser „Schutzzonen“. Nur noch 15 der scheuen Birkhühner verstecken sich auf ihrem „Tanzplatz“ und balzen um den nächsten Walzer. Verständnislos glotzen gutgenährte Esel hinter einem Zaun uns Ultraläufern hinterher. Von dem Haus, zu dem sie gehören, ist nichts zu sehen.
Szenenwechsel
Die hinter mir liegenden vierzehn Kilometer sind nur so verflogen, die Kirchturmspitze von Konzern ist nicht mehr zu übersehen. Jetzt höre ich auch die Stimme des Moderators, die Toten auf dem Friedhof und die alte Kirche schweigen noch immer. Es muss so etwa 7:30 Uhr sein, als ich erneut durch den Startbogen in Konzen laufe, wo uns einen johlender Empfang bereitet wird. Sind es korrupte oder skrupellose Marathonläufer, die jetzt hinterlistig klatschen, um uns im nächsten Moment von der Strecke zu brüllen und zu jagen, oder treffen wir hier auf Konzener Bürger die, weil sie nicht mehr schlafen können, nun als Statisten fungieren?
Ab nun beginnt eine neue Kilometerrechnung. Ich kann mich nicht entscheiden, welche ich gedanklich bis ins Ziel raufzählen will. Auf den Schildern am Wegesrand steht die Zahl der gelaufenen Kilometer für den Marathon und darunter die Zahl der gelaufenen Kilometer für den Ultra. So wäre ich bei Marathonkilometer 30, tatsächlich aber schon 44 Kilometer gelaufen. 44 gelaufene Kilometer fühlen sich, nicht nur in den Beinen, sondern eher im Kopf, anstrengender an, als 30 Kilometer. Wobei: irgendwie ist man ja auch stolz, schon 44 Kilometer gelaufen zu sein, anstelle von 30. Denn hätte ich erst 30, dann wären es ja bis ins Ziel noch 26 Kilometer. Dabei sind es doch nur noch 12 Kilometer. Völlig verwirrt beschließe ich, das Zählen sein zu lassen und konzentriere mich lieber wieder aufs vorwärtskommen.
8:00 Uhr in Monschau
Wenige Stunden nach Sonnenaufgang erliege ich von neuem dem Charme vergangener Zeiten beim Durchlaufen des mittelalterlichen Städtchens Monschau. Am Ortseingang beginnt mit dem Kopfsteinpflaster die kurze Zeitreise. Denn die gut erhaltene und restaurierten Burg sowie die Überreste ferner Vergangenheit beflügeln die Vorstellungskraft. Gerade so früh am Morgen ist die Altstadt noch von Touristen befreit. Anders als gestern, bei meinem Sightseeing Programm, als zwischen müden und dickbäuchigen Besuchern gleich 160 Mountainbiker über das Kopfsteinpflaster donnerten – übrigens ein weiterer Programmpunkt des vielseitigen Marathonwochenendes. Verschwitzt und dreckig statt im feinen Sonntagstaat begrüßt mich wenigstens die Kirche mit ihrem Geläut. Es ist kurz nach acht Uhr, als ich direkt auf das berühmte Rote Haus zu laufe.
Gegenüber das Café, in dem ich gestern war. Die freundliche Bedingung versprach mir, sie wolle mir zujubeln, wenn ich hier vorbei komme. Ich hatte es mir ja gedacht – das Café ist noch geschlossen. Zwei Radtouristen haben sich für ihr Frühstück die Stufen am Roten Haus ausgesucht. Die ehemalige Tuchmacherei ist ein gewaltiges Gebäude aus rotem Stein und vielen Fenstern – Prunk draußen wie drinnen. Zur Blütezeit der Tuchmacherei im 17./18. Jahrhundert nutzte man es Wohnhaus. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen wie die Räder der Pferdefuhrwerke voll beladen mit Ballen edlen Tuches über das Kopfsteinpflaster ratterte. Eine Führung durch die Stadt erzählt von dem interessanten Aufstieg, aber auch vom Niedergang der großen Tuchmachertradition in Monschau.
Verfolgungsjagd
Die Strecke führt über eine Brücke. Unter mir gurgelt das rostbraune Wasser der Rur. An diesem Fluss geht es nun auf einem schmalen Waldweg in den Wald hinein. Ich genieße das Plätschern des Wassers und das Singen der Vögel. Plötzlich, wie aus dem Nichts, halt eine laute Stimme durch den Wald: „Einen wunderschönen guten Morgen…“. Ich versuche die Richtung, aus der die Stimme kommt, zu orten, glaube kurz an Lautsprecher zwischen den Bäumen. Kurz darauf bemerke ich, wie mich in rasender Geschwindigkeit ein Läufer versucht einzuholen, ein weißes Fahrzeug folgt ihm. Die Situation wird brenzlig. Gleich wird er mich erwischen, denke ich, und schon rast der erste Mann des Marathons an mir vorbei über die hölzerne Kluckbachbrücke, als suche er im Wald Zuflucht. Für das Fahrzeug endet hier der Weg. Zwei andere Läufer folgen ihm.
Alles geht so rasend schnell, dass ich meine, mithalten zu müssen. Kurz darauf bin ich völlig außer Atem und von den Läufern ist keine Spur mehr zu sehen. Für kurze Zeit kehrt wieder Ruhe ein. Es sollen die letzten ruhigen Minuten werden. Von jetzt an werde ich Schlag auf Schlag von den schnellen Marathonläufern überholt. Es spornt mich an und holt mich aus meinem Ultra-Trottel-Schritt. Im dichten Eifel-Wald geht es nun steil Berg an. Kurz bevor die Strecke in das Gegenteil kippt, rast elegant wie eine Ballerina die erste Marathon-Frau an mir vorbei.
Sie geizt nicht mit ihren Reizen. Warum auch? Manche der schnellen Damen sind irgendwie Unisex-Wesen oder dürre Hungerhaken. Aber diese Läuferin hier zeigt, dass man schnell und sexy sein kann. Sie hat nur wenige Läufer vor sich, aber umso mehr hinter sich gelassen. Einige versuchen verbissen dranzubleiben. Um es vorneweg zu nehmen: Svitlana Smitiukh, wird das Tempo durchhalten und den Marathon in 3:15:10 Stunden für sich entscheiden.