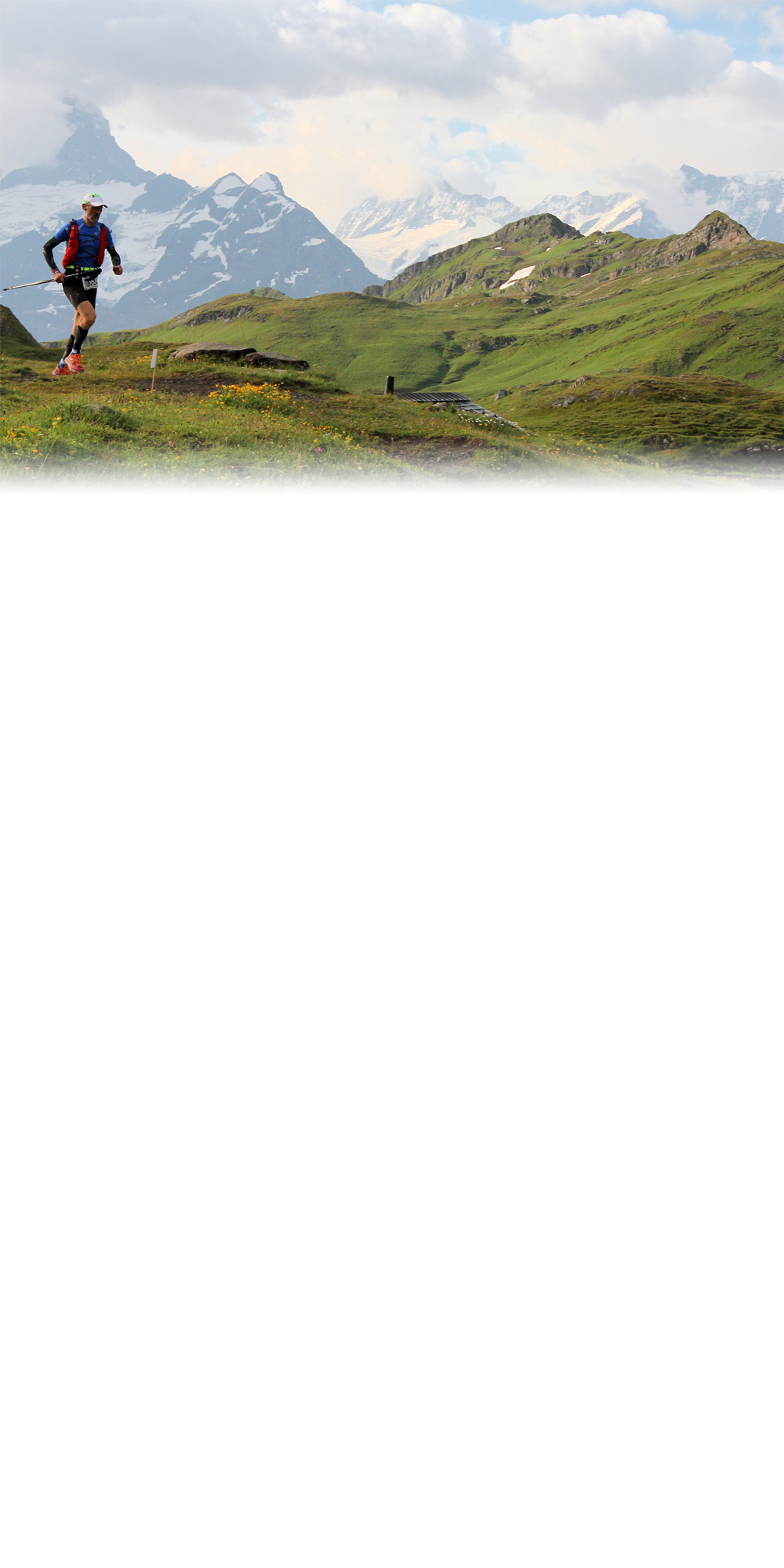12.03.17 - Special Event
Ultra Trail Chaouen (UTC): Le Grand Bleu
Zum Ultra Trail Chaouen (UTC) über 85 Kilometer und 3800 Höhenmetern in Marokko fliegt man für 19,99 mit Ryan Air nach Tanger. Die spanische Sierra Nevada ist schneebedeckt, die Exklave Ceuta größer, als ich dachte und der hohe Grenzzaun gut erkennbar. Der Landeanflug beginnt über den weißen Gipfeln des Rifgebirges, das ich morgen durchqueren werde.
Von Tanger nimmt man den CTM-Bus für 3 Euro und landet in der blauen Stadt Chefchaouen. Die Farbe Blau soll vor dem Bösen Blick schützen, denn Chefchaouen galt bis zum 20. Jahrhunderts als heilige Stadt, deren Besuch Ausländern (per Todesstrafe!) verboten war. So blieb die mittelalterliche Architektur erhalten und zählt jetzt zum Weltkulturerbe.
1906 annektierte Spanien den nördlichen Teil Marokkos. Ohnehin wurde hier spanisch gesprochen, weil sich nach der christlichen Rückeroberung der Iberischen Halbinsel 80 Familien iberischer Muslime und Juden (Alhambra-Edikt) hier niederließen (1492). Chefchaouen wurde Hauptbasis der spanischen Armee, der verbotene Status der Stadt wurde aufgehoben. 1921 kam es zum Aufstand der deutschfreundlichen Berber. Deren Anführer Abd al-Karim hatte bei Mannesmann gelernt, und Mannesmann hatte kein Interesse daran, dass das rohstoffreiche Marokko Kolonie von Frankreich oder Spanien wird.
Aber erst 1956 zogen die Spanier ab. 1975 bekam Chefchaouen den Status einer Provinz und damit endlich Geld aus Rabat. Hippies entdecken die Stadt und das Rif-Gebirge wurde zum Kiff-Gebirge.
Chefchaouen wird allgemein nur Chauoen genannt. „Chef“ bedeutet „ Aufpassen“ (die Berber stammen teilweise von den Germanen ab), „Chaouen“ bedeutet „Die Hörner“ und bezieht sich auf die zwei Berge, unter denen sich die Stadt befindet. Oben ist das Naturschutzgebiet Jbel Bouchamen. Die Häuser in der Medina von Chaouen wurden nie von Ortsfremden gekauft, die übliche Umwandlung in Riads für Touristen, wie es in Fes oder Marrakesch geschehen ist, blieb aus. Die Moschee im Ortsteil von Targa stammt aus dem 13.Jahrhundert.
Der Aufstieg vom Busbahnhof (Gare Routiere) zum Place Outa el Hammam, wo man sich für den Lauf einschreibt, ist ein kleiner Vorgeschmack dafür, was mir morgen bevorsteht. Eines der kleinen blauen Taxis hätte 1 Euro gekostet, aber ich bin ja Läufer. In der Medina ist also alles blau. Fast, denn plötzlich ruft jemand: „Stop! Dangereux!“ Da werde ich schon heftig angegiftet und lerne, dass man niemals blaue Wege gehen darf. Die sind privat. Und hier versteht man keinen Spaß, seitdem Japaner die schönste Stadt Marokkos für sich entdeckt haben. Ansonsten gibt es noch junge Menschen, die mit verfilzten Haaren und selbstgemachten Tattoos rumlaufen. Also: man darf nur unbemalte Wege gehen.
Angemacht wird man hier nicht so wie in anderen marokkanischen Städten, wenn man mal von den versifften Hasch-Händlern absieht, die einem „Schokolade“, „Pasta“ oder sonst was verkaufen wollen. Gesprochen wird Arabisch, Spanisch, Englisch, selten Französisch. Tarifit, die Sprache der Rif-Kabylen, hört man nur oben in den Bergen.
Für die 85 km (es gibt noch 42 und 20 km) wird eine erweiterte Pflichtausrüstung gefordert. Für Trails in Marokko sind Micropourtabletten wichtig. Hätte ich die letzte Woche auf den Philippinen gehabt, dann wäre mir einiges erspart geblieben. Da man eine Tablette auf 0,5 Liter nimmt und 30 Minuten warten muss, bevorzuge ich 0,5 Literflaschen als Wasserreservoir und nicht den Camelbak. Da man sich in Marokko grundsätzlich erst kurz vor dem Lauf einschreibt, erfolgt auch die Kontrolle der Pflichtausrüstung direkt auf dem Platz, in der Hitze des Tages, nach einem anstrengenden Aufstieg. Das ist nicht nach meinem Geschmack.
Ganz oben im Hotel Atlas Chaouen bekomme ich eine Übernachtungsmöglichkeit. Dort ist morgen früh um 5 Uhr der Start und nicht um 6 Uhr, wie es in der Ausschreibung steht. In den folgenden zwei Tagen wird mir der Auf-und Abstieg zu diesem Hotel dasLeben schwer machen. In die Oberstadt kommt kein Auto, kein Japaner, kein Kiffer, die Gassen sind zu eng, der Aufstieg zu brutal. Für mich brutal ist die Verpflegungssituation bei marokkanischen Läufen, denn der Mensch lebt nicht von Wasser und Brot allein. Also gehe ich auf die Suche. Und das ist freitags ein Riesenproblem in einem moslemischen Land.
Morgane ist für die Verpflegungsstationen zuständig. Sie bringt die Kiste mit meiner mühsam zusammengestellten Eigenverpflegung in das Jugendsportzentrum, wo die Nahrungsmittel für die 8 Stationen verteilt werden.
Der 30jährige Ultraläufer und Boss der Veranstaltung, Youssef Al Achhab, macht das Briefing. Das wird kurzfristig auf den großen Platz verschoben, dann doch wieder nach oben ins Hotel, dann doch wieder auf den Platz. Wir sind genervt und nassgeschwitzt, denn dieses Bergtraining ist nicht eingeplant. Sarah Pemberton, eine 23jährige Spitzenläuferin aus GB, hält die ganze Zeit Händchen mit ihrem Boy und lächelt überlegen. Sie fragt zweimal, ob morgen vor dem Start die Ausrüstung nochmals kontrolliert wird. „ Natürlich, du musst um 4 Uhr da sein, es sind nur 20 Ultraläufer, da ist Zeit genug, um nochmals die Pflichtausrüstung zu kontrollieren.“
Das „Road Book“ ist ein informationsloses, laminiertes Blättchen mit Werbung für diesen Lauf.
In der Presse stand, es werden 300 Läufer sein, auf der Website sonst gar nix. Ich bin von Natur aus blauäugig, deswegen stehe ich auf neue und unorganisierte Läufe. Es ist eine Faszination, die mich nicht mehr loslässt.
Der Titel der heutigen Geschichte, „Le Grand Bleu“, ist der Originaltitel des Films „Im Rausch der Tiefe“. Damit spiele ich auf das Ende des Filmes an, als der Apnoetaucher Jacques, geführt von einem Delfin, im tiefen Blau des Ozeans entschwindet. Ein Bild, das mir in dem folgenden, einsamen Nachtlauf rund um die blaue Stadt immer wieder durch den Kopf gehen wird. Zeitlimit sind 24 Stunden. Da gibt es nichts zu grinsen. Hier ist Afrika und oben in den Bergen gibt es kein „ich bin ein Star…“.
Samstag, 5 Uhr Start vor dem Hotel (700 m Höhe). Irgendwer leitet mich in einen Container. Dort nochmal Briefing, 8 Läufer sind nicht angetreten, wir sind also zwölf. Im letzten Jahr mussten einige Läufer im Schneetreiben aufgeben, die Wege waren schlammig, es gab Verletzte. Mich erwartet heute Sonnenschein mit 5-40 Grad.
Bestimmt kommen später noch 288 Marathonläufer auf die Strecke, denn so stand es in der Presse. Dann sagt man mir stolz, es werden 30 Marathonläufer sein: „Oui, Oui, la presse, c est un autre chose.“
Gestern erfuhr ich noch, dass man einen Drop-bag abgeben kann, hier von zwei Helfern „comfort-baggage“ genannt, wobei ich mit „equipaje para ropa reemplazo“ mehr Aufmerksamkeit bekomme. Ich wüsste nur gerne, an welchem Kontrollpunkt ich meine Klamotten finden werde. Oh, bin ich blauäugig! Le Grand Bleu beginnt!
Oh nein, Le Grand Bleu, das sagt mir aber niemand, begann heute um 3 Uhr, als im Jugendsportzentrum meine Eigenverpflegung von „les officiales“ konfisziert wurde. In einer Stadt, wo an jeder Ecke gekifft wird, konfisziert man die Eigenverpflegung von Deutschlands bekanntesten, biertrinkenden Ultraläufer. Und ich sehe auch nicht die Kreideschrift der Soldaten auf den Waggons: „Weihnachten sind wir wieder zuhause“.
Der erste 1100 Meter Aufstieg beginnt. Fehlgeleitet von einem ahnungslosen Helfer (normal) kommen mir meine Leidenskollegen entgegen. Ich raffe schnell, drehe um, liege auf Platz eins, lasse mich aber dann aber voller Respekt zurückfallen.
Vom ersten Aussichtpunkt gibt’s nun einem geilen Blick über die blaue Perle Chaouen: die majestätische Kasbah, den inneren Gartenund die alte Medina, die von einer mit Zinnen bewehrten Mauer umgeben ist, alles überragt vom Turm der Moschee( 15.Jahrh). Und dann ist Gebetszeit. Es beginnt der einschläfernde Morgengesang „Allahu Akbar“, und da Chaouen sehr konservativ ist, gibt es an jeder Ecke Lautsprecher, die miteinander wetteifern. Ein fremdartiger Klangteppich liegt über der blauen Stadt, die nun im Licht der Laternen gelb leuchtet.
Nach wenigen Metern sind wir im Nationalpark Tallasemntane (klare Quelle). Ein Park mit enormen Schluchten, der die letzten Reste von Tannen und Kiefern, die die Römer nicht abgeholzt haben schützt. Unser Trailrevier wird immer wieder in das Gebiet des Nationalparks eindringen, der eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen beherbergt, die hier im europäisch/afrikanischen Bereich endemisch sind. Ich werde Ausschau nach Berberaffen, Ottern, Gold- und Königsadlern und Bartgeier halten. In manchen Reiseführern wird von Wölfen erzählt. Das ist ein Übersetzungsfehler der Engländer, Füchse sind keine Wölfe. Wildschweine werden wir auch nicht sehen. Die Skorpione sollen nicht so giftig wie im Hohen Atlas sein, bis auf den roten Skorpion. Also sollte man nachts nicht unter Steine greifen, was ein Läufer normalerweise ja auch nicht macht. Jetzt im Frühling ist die Hufnasennatter aktiv. Ich auch.
Steil geht es hinauf, bis wir zum Oued (Trockenfluss) Tisemlal gelangen. Hier sammelt man das Wasser für die Stadt, speist es in die vielen Brunnen ein, die seit dem Mittelalter aus weiß-blau gekachelten Wänden sprudeln. Unter uns präsentiert sich noch Azilane, die kleine blaue Schwester von Chaouen, ein letztes Mal in seiner ganzen Schönheit, dann passieren wir einen aufgegebenen mittelalterlichen Kalkofen. Mit dem Kalk werden Häuserwände verputzt. Kalk ist wegen seines hohen PH-Wertes antibakteriell und verhindert Schimmel.
Oben am Jbel-El Kelaa (1616 m) sehe ich die Stirnlampen der letzten zwei Läufer, dann bin ich allein. Der Sonnenaufgang kündigt sich an, ich erkenne die schroffen Spitzen des Gebirges. Eine Eule begleitet mich, macht mir klar, dass dies ihr Revier ist. Der Weg wird ein wenig ebener, dann geht es weiter hinauf nach Ain Tissimlane, das von den hohen Kalksteinwänden des Sfiha Telj überragt wird. Der Blick ist beiseitig phantastisch, man sieht sogar das Mittelmeer.
Nach zwei Stunden bin ich am Pass Chouihate auf 1820 m Höhe und am ersten PC (Point Control). Die Frage nach meiner Eigenverpflegung, die Morgane doch verteilt haben muss, wird ignoriert und mir ist klar, ich muss spanisch sprechen. Man versteht, schaut mich entsetzt an: „Was bisten du für einer?“ Augenblicklich wird mir eiskalt, hinter dem PC sind Schneereste. Von nun an geht es 1500 Meter steil bergab, augenblicklich schmerzen die Oberschenkel.
Bei km 16 liegt unter mir Afeska und vor mir der nächste PC. Auch hier meine verzweifelte Frage nach meiner Eigenverpflegung. Alle schauen mich nur entgeistert an. Die Strecke wendet sich nach Norden, Richtung Sidi (heilige Quelle) Meftah. Hier ist ein Marabout, eine Begräbnisstelle eines Heiligen. Es geht aus dem Wald hinaus und in Serpentinen runter nach Imizzar am glasklaren Qued Farda. Hinter dem Fluss geht ein Weg unterhalb beeindruckender, überhängender Felsen entlang, steil hinab, man sieht den Grund der Schlucht nicht. Das Geröll ist sehr schwer zu laufen, ich muss seitlich gehen.
Die Brücke Pont Farda stammt aus ganz alter Zeit, das Wasser lädt zum Reinspringen ein. Der gegenüberliegende Hang liegt breit in der Sonne und ist knochentrocken. Nach einer weiteren Stunde komme ich nach Ouslaf (km 32), das von einer gigantischen Felssäule überragt wird.
Akchour (km 34) liegt nun schon wieder auf einer Höhe von 398 Metern am Oued Kelaa, wo ein einladendes Café seine Getränke im Fluss kühlt. Von hier aus gäbe es über eine holprige Piste eine Rückfahrtmöglichkeit mit den Helfern nach Chaouen. In Talembote könnte man sich auch noch für 15 Dirham (1,5 Euro) ein Taxi nehmen. Ich kaufe mir vier Flaschen warme Cola. Normalerweise laufe ich solches Terrain mit 1,5 Litern Flüssigkeit auf 10 Kilometern, jetzt habe ich 5 Liter dabei. Eine glückliche Fügung, die mir in den folgenden Stunden das Leben retten wird.
In Akchour geht es am wilden Oued Kelaa wieder hinein in den Nationalpark Tallasemntane. Wenn man jetzt am unbesetzten Parkwächterhäuschen rechts laufen würde, dann käme man in das Land der Mgou, der Berberaffen. Es ist hier relativ touristisch, man macht Picknick auf kleinen Terrassen, von denen der Duft gegrillten Fleisches aufsteigt. Ich steige auch auf - und das in einem Zug von 400 Metern auf 1800. Nach 2 Kilometern entlang des verlockenden Wildwassers empfängt mich transzendentes Trommeln: Vor einer winzigen Hütte sitzen 30 Jugendliche mit verfilzten Haaren, der duftende Qualm stammt nicht vom Grill. Ich bin völlig benebelt wegen der Hitze und verfehle zunächst den Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so brutal am Rande des Abgrundes entlanggehen soll. Aber es ist so. Ich will nicht mehr!
Dann entdecke ich die Gottesbrücke: Ein sagenhafter, roten Steinbogen, eine unglaublich hohe Naturbrücke, die den Fluss überspannt. Über Jahrtausende muss der Fluss unterirdisch diesen Bogen geschaffen haben und kam dann auf die Idee, uns seine Arbeit zu präsentieren. Ich bin so wacklig auf den Füßen, dass ich nur zaghaft ein Foto in die Tiefe schießen kann. Kaum habe ich den Übergang geschafft, muss ich mich hinlegen. Es gibt nicht viele Läufe, bei denen ich mich ablegen musste, hier ist die Hitze, die extreme Steigung und die Unterzuckerung schuld. Die Nahrung bei den PC´s ist gut gemeint, ich erwarte keine Schmalzbrote. Aber die Kekse sind der Horror, da schmecken die Panzerplatten von der Bundeswehr besser. Die Erdnüsse sind ungeröstet und auf der braunen, lockeren Haut kleben Bakterien, die sich nicht vorteilhaft auf die Verdauung eines Läufers auswirken. Die Rosinen sind klasse, die Datteln Spitze - wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat.
Sobald ich ein wenig Schatten finde, setze ich mich hin und hechele, wie der unterlegene Hahn letzte Woche auf den Philippinen. Nach zwei Stunden geht es mir besser, ich kann zum Mittelmeer schauen, ich mache Fotos von den majestätischen Bergen und freue mich über die Blüten des gelben Ginsters, die von den blauen Lavendelblüten abgelöst werden.
Nochmal zwei Stunden später erreiche ich CP 5 und habe mehr als die Hälfte geschafft. In einem Pappbecher nehme ich mir eine Handvoll Nudeln mit. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen und muss zügig weiter. Plötzlich huscht ein kleiner, schwarzer Saskatchewan den Straßenhang hinauf. Ich bin zwar fertig, aber ich habe keine Hallus, niemals! Dann hüpft ganz leise ein weiterer Saskatchewan vor mir auf die Strecke. Es ist ein Berberaffe. Demonstrativ zeigt er mir seinen Rücken, er will mit mir nichts zu tun haben. Gott sei Dank!
Relativ schnell und freudig erreiche ich den Pass „Plaza Espana“ auf 1800 Meter Höhe. Dort sitzt Mohamed und zittert wie Weltmeister. Er wird der Einzige von uns Zwölfen sein, der aufgibt. Mir geht’s gut, obwohl man mir einredet, ich solle aufgeben. Immer wieder treffe ich an den Pc´s den dicken Bärtigen, der behauptet, er wäre Rennarzt und ich solle ihm doch bitte in die Augen schauen. Das aber ist nicht so einfach. Er hat braune, ich hab blaue Augen. Außerdem kämpfe ich sichtbar mit dem Gleichgewicht, aber es gibt kaum Sitzmöglichkeiten. Es wird laut gelacht, als ich mich auf die Rückbank eines Autos lege, denn es ist die verrauchte Karre der Parkranger. „Wir fahren dich zurück!“ „Nunca, nunca!“
Hier liegt mein „equipaje para ropa reemplazo“ und ich werfe mir warme Kleidung über und Gels rein. Es sind nur noch 35 Kilometer, in 7 Stunden werde ich im Ziel sein! 1000 Höhenmeter geht es hinab zum CP Bab Taza (km 62), die Parkranger fahren hinter mir her. Immerhin, 50 cm Abstand halten sie ein. Deren Zigarettenrauch vermischt sich mit dem Abgas ihrer alten Karre. Nach 2 Stunden verschwinden sie endlich, als hätte ihre Mutter verkündet, dass das Abendessen fertig ist. Doch auf der nächsten Anhöhe steht die verdunkelte Karre wieder und ein Ranger wirft eine Getränkedose aus dem Fenster. „Das Duell“ (1971) ist ein Thriller von Steven Spielberg, bei dem ein verdunkelter Tanklaster den Geschäftsmann David verfolgt. Der ganze Film ist wortlos, so wie diese Szene, als das verdunkelte Rangerauto oben am Pass steht, und Michnun mir wieder im Abstand von 50 cm folgt. Als es dann aber dunkel wird, bin ich froh, dass ich Scheinwerferlicht habe.
Es sind unglaublich viele Menschengruppen unterwegs ins Tal. Es ist Samstag. Irgendwann komme ich auf die Idee, dass ich schon lange keine Markierung mehr gesehen habe. „Sollen wir die Organisation anrufen?“ fragt der Ranger. Nein, das wäre mir peinlich.
Bei CP Tissouka (km 75) verabschieden sich glücklicherweise meine Betreuer wortlos. Jemand von der Organisation begleitet mich zum nächsten PC, entschuldigt sich permanent, dass er mich in meiner Trance nicht stören wolle, er aber den Leuten bei Nr. 8 Bescheid sagen müsse, dass ich noch komme. Ich bin der letzte Läufer und glücklich über seine Betreuung, muss ich doch nun nicht mehr auf die Markierung achten. Es geht eine fiese Schotterstraße mit viel Verkehr entlang. Es wird wohl überall geheiratet, ganze Kolonnen volltrunkener Kleinbusse brettern vorbei. „Attention, Attention!“, ich springe gerade noch zur Seite, mein Puls springt hoch, als ich den Windhauch des Außenspiegels spüre. Mann, war das knapp!
Bei CP 8, bei Tissouka, verabschiedet sich mein Lebensretter. Ich begreife später, weshalb: die letzten 10 Kilometer sind grausam. Ich diskutiere lange mit allen (10) Anwesenden, erkläre denen, dass die Markierungen scheiße sind, dass ich hier nicht mehr alleine laufen und dass ich endlich meine Eigenverpflegung haben will. Wir einigen uns darauf, dass sie nach 5 Kilometern an der Abzweigung auf mich warten, um mir den weiteren Weg zu weisen. Ich bekomme ein Handy in die Hand gedrückt, das bimmelt auch kurz darauf in der Dunkelheit, ich geh aber nicht dran. Wieder brettert eine Hochzeitsgesellschaft mit 20 Autos an mir vorbei, der Staub raubt mir die Luft.
Vor zwei Stunden hatte ich Cola gekauft und den warmen, überzuckerten Tee in meinen zwei Flaschen im Shop gelassen. Jetzt überholt mich ein Moped. Der Fahrer überreicht mir die zwei weggeworfenen Flaschen, ich bin überwältigt von der Weitsicht. Es waren zwar weggeworfene Flaschen, aber die Aufmerksamkeit dieses Mopedfahrers beeindruckt mich: „Shucran, shucran, mon ami!“ Als er weg ist, werfe ich die Flaschen ins Gebüsch.
Tatsächlich stehen die Helfer vor der Abzweigung hinauf zum Pass, der nach Chaouen führt. Es beginnt ein einsamer Aufstieg, begleitet von einem wunderbaren Vollmond. Oben am Pass sehe ich das gelbe Leuchten der blauen Stadt, doch der Weg hinab ist so grausam, dass ich zwei Stunden für die letzten 5 Kilometer brauche. Etwa 1,5 Kilometer oberhalb der Stadt steht die Jamaa Bouzzafer Moschee. Man nennt sie die „spanische Moschee“, weil sie während des Aufstands gegen die Spanier entstand. Sie diente als Aussichtposten und Versteck. Es gibt einige gelbe, einsame Straßenlaternen um die Moschee herum, sie bewachen die Felder von (noch kleinen) gefiederten Pflanzen. In wenigen Wochen wird man das Harz aus den Blütenständen abstreifen.
Unten in Chaouen gibt es keine Markierung auf den blauen Hauswänden, aber ich kenne mich aus. Katzen, die im Müll wühlen, flitzen schreiend weg, als sie mich sehen. Sehe ich so grausam aus? Es ist 23:33, ich komme nach 18:33 Stunden ins Ziel. Die Verklärung eines Laufes beginnt immer auf der Ziellinie. Jetzt erst recht, als man mir mitteilt, dass man meine Eigenverpflegung im Kofferraum hat, jetzt aber noch nicht die Zeit dafür wäre, weil die Polizei mein Eintreffen überwacht. 15 Minuten beobachtet mich der Doc, dann schickt er Rettungswagen und Polizei zum wohlverdienten Schlaf und mich zur wohlverdienten Eigenverpflegung im Kofferraum.
Gott, bin ich froh, diesen Knaller gefinisht zu haben! Eine warme Suppe, eine heiße Bockwurst mit viel Senf und knackigem Brötchen, das wäre jetzt traumhaft. Aber es gibt Wasser und Bananen.
Als ich im Jugendsportzentrum eintreffe, hämmert der Herbergswirt alle Gäste wach, um ein Bett für mich zu finden. Bei den meisten Zimmern sind die Schlösser kaputt, also hebelt der Typ zwei Räume auf. Ich nehme währenddessen unauffällig Eigenverpflegung auf, schon schnauzt mich der Bär zusammen: „Not allowed!“
In dem Zimmer, was er mir zuweist, stinkt es, als hätte Joey Kelly wieder mal einen verwesten Hasen von der Straße gekratzt. Als ich mich zur Dusche schleppe, ist mir klar warum: Das Wasser kommt frisch vom Berg. Auch ich verzichte lieber aufs Duschen. Als ich mir die Ohrstöpsel reinmachen will, verkrampfen meine Hände, die Stöpsel fallen irgendwo unter die schmutzigen Betten. Egal, mein persönliches „Le Grand Bleu“ habe ich superstark gefinisht. Damit, das darf ich jetzt sagen, hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich nur die blaue Stadt sehen, bevor der Tourismus die Perle erdrückt.
Laufberichte
Meldungen